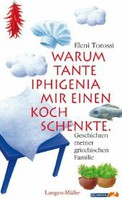
Buch verfügbar?
|
Bratwurst mit gesüßtem Tsatsiki
Eleni Torossi: Warum Tante Iphigenia mir einen Koch schenkte. Geschichten meiner griechischen Familie. - LangenMüller, 2009. - 256 S.
Sie leben, um zu kochen: Die griechische Großfamilie der Autorin Eleni Torossi ist auf zahlreiche Länder verteilt - und aus jeder Kultur nehmen alle nur das Beste mit. Die Tanten Penelopi, Afroditi, Iphigenia und Ourania erzählen ihre Geschichten und lassen sich beim Kochen über die Schulter sehen. Dabei wachsen sie den Zuhörern mit all ihren Marotten und schrägen Ideen ans Herz und stecken mit ihrer Kreativität an: Wer würde bei so abenteuerlichen Kreationen wie Bratwurst mit süßem Tsatsiki oder Spaghetti mit Schokoladensauce nicht am liebsten gleich selbst drauflos kochen? In "Warum Tante Iphigenia mir einen Koch schenkte" schrieb Eleni Torossi die witzigen Koch- und Essgeschichten ihrer Familie auf. Gewürzt mit vielen Rezepten erfährt man so manches über griechische Mentalität und kulinarische Kulturgeschichte.
Andrea Däuwel-Bernd
Eleni Torossi, 1947 in Athen geboren, lebt seit 1968 in München. Sie arbeitet seit 1971 für den Bayerischen Rundfunk, schreibt hauptsächlich Kulturbeiträge und Reportagen, aber auch Kindergeschichten und Hörspiele für Rundfunkanstalten. Ihre eigenwilligen Geschichten und Märchen begeistern Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Mit Phantasie und poetischer Kraft wirbt sie pointiert und unterhaltsam für Individualität und Toleranz. Sie veröffentlicht in deutscher und griechischer Sprache.
Die Lesung mit Eleni Torossi am 1. Oktober um 20 Uhr in der Stadtbibliothek Reutlingen musste wegen Krankheit abgesagt werden.
|
 |
Buch verfügbar?
|
Das BKA auf den Spuren eines Terroranschlages
Wolfgang Schorlau: Das München-Komplott : Denglers fünfter Fall. - Kiepenheuer & Witsch, 2009. - 334 S.
In seinem mittlerweile fünften Fall arbeitet der Stuttgarter Privatermittler Dengler für seinen alten Arbeitgeber, das Bundeskriminalamt. Er soll die Akten der Sonderkommission Theresienwiese zum Terroranschlag auf das Münchner Oktoberfest 1980 prüfen. Schnell wird klar, dass bei den damaligen Ermittlungen manipuliert und bewusst geschlampt worden war: Zeugen starben auf mysteriöse Weise, Asservate verschwanden und vieles mehr. Dennoch sitzen die damals Verantwortlichen auch noch nach 30 Jahren in den Machtzentren der BRD, so dass es bei einem anfänglich einfachen Fall bald um Leben und Tod geht.
Wolfgang Schorlau schafft es in seinem neuen Roman, Realität und Fiktion geschickt zu verweben. So ist ein von der ersten bis zur letzten Seite spannender und mit Sozialkritik gespickter Krimi entstanden, der, auch wenn er in Stuttgart und Tübingen spielt, ohne die klassischen Merkmale eines Regionalkrimis auskommt.
Barbara Münz |
 |
DVD verfügbar?
|
Eine palästinensisch-israelische Geschichte der Hoffnung -
Ein Beitrag zur Interkulturellen Woche vom 26.09. bis 02.10.2010
Das Herz von Jenin. - Regie: Leon Geller, Marcus Vetter. - 2009. - 1 DVD, 89 Min.
Zwei schwer verdauliche Themen werden in diesem berührenden Dokumentarfilm von einem deutschen und einem israelischen Regisseur emotional intensiv miteinander verwoben.
Der zwischen den beiden Intifadas im Lager geborene zwölfjährige Palästinenserjunge Ahmed wird von einem israelischen Soldaten erschossen, als er mit einem Spielzeug-MG über einen Platz in Jenin im besetzten Westjordanland läuft. Er schwebt einige Tage in Lebensgefahr, doch die jüdischen Ärzte in Haifa können sein Leben nicht mehr retten. Der behandelnde Arzt bittet den Vater Ismael Khatib um die Organe seines Jungen für andere Kinder. Das Gespräch ist eindringlich, äußerlich ohne Emotionen, doch innerlich tief bewegend. Ahmeds Vater ringt mit sich und dieser fast unmenschlich schweren Entscheidung, telefoniert mit seiner Frau und beschließt, die Organe freizugeben, um anderen Kindern eine Chance zu geben, die sein Sohn nicht mehr hat. Dabei ist ihm bewusst, dass es israelische, darunter auch jüdisch-orthodoxe Kinder sind, die mit den Organen seines Sohnes weiterleben werden. Zunächst möchte er Ahmeds Herz nicht verpflanzen lassen, doch nach einiger Bedenkzeit kann er sich sogar zu diesem Schritt durchringen.
Der oftmals durch israelische Schikanen gedemütigte Ismael verschweigt nicht, dass er ein ehemaliger Widerstandskämpfer ist, der als junger Mann Molotowcoctails und Steine geworfen und dafür mehr als einmal im Gefängnis eingesessen hat. Sein Geschäft wurde mehrfach von Israelis zerstört, und er musste sich eine neue Existenz aufbauen, um seine Familie ernähren zu können. An der Staatsgrenze zu Israel wird er wie andere Palästinenser aufgehalten und unnötig lange kontrolliert. Aber es ist nicht Hass, der ihn zersetzt, sondern Erkenntnis, die in ihm reift, dass es Menschen gleich welcher Nationalität und welchen Glaubens sind, für die er diese Entscheidung trifft. Er geht diesen Weg bewusst, um ein Zeichen zu setzen und sich damit von der aufgebrachten Menge der Palästinenser zu distanzieren, die für einen Toten hundert Tote der Gegenseite fordern. Er glaubt, auch den Israelis wäre es lieber, er würde sich für den Tod seines Sohnes mit Gegengewalt rächen. Doch es ist nicht mehr sein Weg. Er versteht diese Entscheidung als Widerstand gegen die Gewaltspirale.
Ismael baut mit Unterstützung einer italienischen Stadt in Jenin ein Kulturzentrum für 200 palästinensische Waisenkinder auf, deren Leiter er wird und fragt im Krankenhaus in Haifa um Hilfe für kranke Kinder nach. Dazu sucht er den Arzt auf, der ihn um Ahmeds Organe gebeten hat. Anschließend besucht er drei der fünf Kinder, die mit Ahmeds Organen weiterleben: den Beduinensohn Mohammed, das Drusenmädchen Samah und die jüdisch-othodoxe Menuha in Jerusalem. Die jüdisch-orthodoxe Familie hatte gehofft, dass es ein Jude sein möge, der die Organe für ihr Kind spendet. Sehr unterschiedlich verlaufen diese Begegnungen. Ein neun Monate alter Säugling hat die Transplantation nicht überlebt.
Ohne auf die Problematik der Organspende einzugehen, bei der man auch zu einer anderen Entscheidung kommen darf, macht Ismaels Menschlichkeit in dem Film offenbar, dass nur solche Wege von beiden Seiten aus der Hoffnungslosigkeit führen und einen dauerhaften Frieden in einer Region zu bewirken vermögen, die seit Jahrzehnten von Terror, Unrecht, Unterdrückung und menschlichen Tragödien geprägt ist.
Tanja Schleyerbach |
 |
DVD verfügbar
|
Von Anatolien nach Köln -
Ein Beitrag zur Interkulturellen Woche vom 26.09. bis 02.10.2010
Zeit der Wünsche. - Regie: Rolf Schübel. - 2005. - 1 DVD, 176 Min.
Der 2005 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnete Film erfüllt alle Voraussetzungen für ein perfektes Drama. In drei Stunden, in denen auch beim zweiten Ansehen keine Minute Langeweile aufkommt, wird die Freundschaft zwischen den anatolischen Kindern Melike, Mustafa und Kadir authentisch und packend dargestellt. Melike liebt Mustafa - und Mustafa liebt Melike. Während Mustafa zusammen mit Kadir als Gastarbeiter in den 60-er Jahren in Deutschland sein Glück versucht, weiß Yasar, der in Anatolien bleibt, zu verhindern, dass ihre Liebesbriefe ankommen und Mustafa um Melikes Hand anhält. Als Kadir Mustafa um sein für die Heimreise Erspartes bittet, schlägt Mustafa ihm diese Bitte zunächst ab - und lässt sich schließlich erweichen. Er bleibt in Köln, und Melike ist verzweifelt, auf keinen ihrer Briefe hat Mustafa ihr geantwortet. Der Wunschbaum hat versagt.
Schließlich ergibt sie sich nach jahrelangem Warten und heftigem Widerstand gegen ihre Eltern in ihr Schicksal, heiratet Yasar, der verrückt nach ihr ist, und bekommt mit ihm sogar zwei Kinder. Kurz nach der Hochzeit trifft Mustafa ein, um um ihre Hand anzuhalten, und er ist wie betäubt, als er sie mit Yasar unglücklich verheiratet sieht. Melike überwindet ihren Ekel vor Yasar und arrangiert sich, bis sie ebenfalls nach Deutschland als Gastarbeiterin auswandert und ihre Kinder in der Türkei zurücklässt. Männer werden zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr gebraucht, und Yasar muss sie ziehen lassen, weil die Arbeit im Dorf die Familie nicht mehr ernährt. In Köln trifft Melike Mustafa wieder, der mit einer blonden Frau zusammenlebt und als Fotograf zudem von ihr abhängig ist. Zum ersten Mal kommen sich die beiden Liebenden wirklich näher, und Mustafa gesteht ihr, dass er nie eine andere geliebt hat. Doch der Tratsch dringt bis nach Anatolien vor, und sie müssen sich nicht zuletzt vor ihrem Freund Kadir in Acht nehmen, der sich zu einem religiösen Fanatiker gewandelt hat und seine Frau und Tochter plötzlich in Kopftücher und lange Kleider zwingt. Er trägt einen Bart und kleidet sich wie ein strenggläubiger Moslem, und er wirft Mustafa seine Liebe zu Melike vor. Zu allem Unglück kommt Yasar mit den Kindern nach Deutschland, und Melike weiß nicht mehr, was sie tun soll. Yasar kommt mit dem Leben in Köln nicht zurecht und wird gewalttätig.
Als Melike erfährt, dass Yasar ihre Briefe abgefangen hat, trennt sie sich sofort von ihm. Nun ist der Weg für sie und Mustafa frei, der inzwischen seine deutsche Freundin verlassen hat. Es soll der glücklichste Tag ihres Lebens werden, als Mustafa um ihre Hand anhalten will. Doch Yasar weiß dies auch ein zweites Mal zu verhindern. Allein Melikes Tod versöhnt die sich entfremdeten Freunde Mustafa und Kadir am Ende wieder.
Tragisch sind nicht nur die unerfüllte Liebesgeschichte und die zerbrechlichen Freundschaften, anrührend und einfühlsam werden vor allem die Geschichte und Schicksale der türkischen Gastarbeiter in Deutschland thematisiert, das Verlassen ihrer Heimat, der Abschiedsschmerz und die Trennungen, ihre Wünsche und Hoffnungen auf ein Land voller Verheißung, die harte Arbeit und die Schwierigkeiten, die Demütigungen und ihre Missachtung, die Verzweiflung, ihre innere Emigration und Anpassung an ein so andersartiges Leben. Sie ist die eigentliche traurige Botschaft dieses Films mit hervorragenden Schauspielern.
Tanja Schleyerbach |
 |
Buch verfügbar?
|
Melancholisch-maliziöse Bilder von der Zweisamkeit
Sibylle Berg: Der Mann schläft. - Hanser, 2009. - 308 S.
Die Liebe, das Glück, die Nähe - und warum all das so schwer festzuhalten ist: Davon erzählt Sibylle Bergs Roman "Der Mann schläft". Und auch von Verlust, Einsamkeit und vom Älterwerden. Vor allem vom Älterwerden, und dass es nicht berührt, wenn man nur die Zweisamkeit genießen kann.
Eine Frau hat den Mann ihres Lebens gefunden, einen, der ihr das Gefühl gibt, liebenswert zu sein und mit dem sie sich vorstellen kann, alt zu werden. Die Beziehung ist keine leidenschaftliche, sie ist eingespielt, harmonisch, ruhig und das, was die Frau als Glück empfindet. Aber dann verreist das Paar auf eine Ferieninsel in der Nähe von Hongkong. Und dort kommt ihr der Mann einfach abhanden. Eines Tages ist er weg, spurlos verschwunden. Die Frau sucht vergeblich und wartet auf seine Rückkehr. Und während sie auf der Insel einsam ist, lässt sie in Rückblicken die Liebe, die Vertrautheit, die Gemeinsamkeit wieder präsent werden. Und in diesen Rückblenden sucht sie nach dem verlorenen Glück, nach dem Sinn des Lebens und der verschwundenen Geborgenheit.
Sibylle Berg erzählt eine moderne und ganz leise Liebesgeschichte, und sie zeigt mit ihren so melancholischen wie maliziösen Bildern und ihrer präzisen, bildreichen und sarkastischen Sprache eine Welt, in der es sich nur lohnt zu überleben, wenn man nicht ganz alleine ist. Sie erzählt wunderbar bösartig von Überdruss und Hoffnung, von Melancholie und Zuversicht.
Andrea Däuwel-Bernd
Der Titel ist auch als Hörbuch, eBook und eAudio entleihbar.
|
 |
|

DVD verfügbar?
|
Schräge Vögel, komische Szenen und liebenswerte Darsteller - Ein Beitrag zum Weltalphabetisierungstag am 8. September
Saint Jacques... Pilgern auf Französisch. - Regie: Coline Serreau. - 2008. - 1 DVD, ca. 104 Min.
Clara, Claude und Jacques stehen vor der Erbschaft ihrer Mutter, die an eine schier unerfüllbare Bedingung geknüpft ist: die drei müssen, bevor sie ihr Erbe antreten, unter Aufsicht des Reiseleiters Guy den französischen Jakobsweg zusammen pilgern. Claude ist chronisch arbeitslos und leidenschaftlicher Alkoholiker, Jacques ist in der Firma unersetzlich und Worcaholic aus Überzeugung, und die bissige Lehrerin Clara lässt keinen Streit mit ihm aus. Was sie eint, ist ihre Unsportlichkeit gepaart mit einer unverhohlenen Abneigung gegen das Laufen, ihr Agnostizismus und ihre gegenseitige Antipathie. Einzig Jacques ist auf die Erbschaft nicht angewiesen, lässt sich aber dennoch auf das Unterfangen ein. Ihre Mitwanderer: Ramzi, ein liebenswerter Analphabet, der sich auf dem Weg nach Santiago de Mekka glaubt, dessen Cousin Saïd, der nur seiner Schulfreundin Camille wegen mitgegangen ist, die allerdings mit ihrer Freundin Elsa unterwegs ist und nichts als ihre Ruhe vor ihm haben möchte, sowie Mathilda, eine Krebspatientin nach der Chemotherapie auf Sinnsuche. Auch oder gerade weil sich die Komödie vorhersehbar und beschaulich entwickelt, kann man sich vollkommen auf die komisch-überzeichneten Charaktere, die bezaubernde Filmmusik und die wunderbaren Landschaftsaufnahmen einlassen. Natürlich hat das entschleunigte Roadmovie nicht das Geringste mit ernsthaftem Pilgern zu tun, und so entlarvt Serreau en passant die zahllosen Trittbrettpilgerer, die, weil es en vogue ist, auf Hapes Spuren wandeln.
Am Ende kann Ramzi Lesen und Schreiben, die kratzbürstige Clara hat es ihm beigebracht, die drei Geschwister sind nach etlichen, die Gruppe an den Rand der Verzweiflung treibenden Streitereien nahezu handzahm geworden, Saïd kann seine geliebte Camille doch noch für sich gewinnen, und auch Mathilda findet im Reiseleiter Guy ihren Lebenssinn auf dieser Reise. Einzig der Tod von Ramzis Mutter, für die er doch endlich Schreiben und Lesen gelernt hat, hinterlässt einen wehmütigen Hauch Mitgefühl mit diesem gutmütigen und nun einsam-verzweifelten arabischen Jungen.
Liebenswerte Darsteller, komische Szenen und schräge Vögel sorgen für 100 Minuten beste Unterhaltung.
Tanja Schleyerbach
|
 |